GeoDict 2021 Vorschau: GeoDict - Werkzeuge für Bildverarbeitung und -analyse
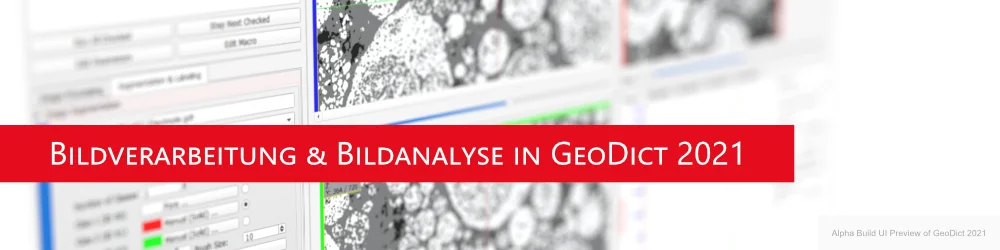
Mit der Gründung der Math2Market GmbH im Jahr 2011 haben wir uns zum Ziel gesetzt, unsere Leidenschaft für Mathematik und Fortschritt in Form einer einfach zu bedienende und vielseitige Simulationssoftware für jedermann nutzbar zu machen. Wir sind sehr stolz auf die daraus entstandene Software, mit dem Namen GeoDict. Unser Ehrgeiz, diese stetig zu verbessern, treibt uns zu Höchstleistungen an. Hier fühlen wir uns als Akademiker zu Hause - nahe an Wissenschaft, Forschung und Entwicklung. Unsere Kunden und Kollegen inspirieren uns täglich GeoDict zu einem noch besseren Werkzeug zu machen und dafür sind wir dankbar. Sie stellen uns vor neue Herausforderungen, die wir nur allzu gerne annehmen.
Aber die größte Herausforderung stellen wir uns selbst – „Tue Gutes und sprich darüber.“ Viel zu selten nehmen wir uns die Zeit, um unsere Features und unser Wissen mit anderen zu teilen. Viel zu häufig hören wir "Was, das kann GeoDict?!". Unsere Leidenschaft mit anderen zu teilen und zu kommunizieren ist die Devise für dieses Jahr und für den kommenden GeoDict Release 2021 - Tue Gutes und sprich darüber.
Deshalb haben wir uns einmal selbst gefragt: "Was genau kann GeoDict im Bereich ... ?".
Was genau kann GeoDict im Bereich Bildverarbeitung und Bildanalyse von 3D-Datensätzen?
Mit dem Modul ImportGeo-Vol bietet GeoDict einen reichhaltigen Werkzeugkoffer, um den vollständigen Bildverarbeitungsworkflow für Bilddatensätze abzubilden.
Beginnend mit der Bilderverarveitung bis hin zur Segmentierung und den daraus resultierenden 3D Mikrostrukturen. Mit GeoDict kann man diesen Workflow nicht nur bequem in nur einer Software ausführen, sondern auch voll automatisieren. In den letzten Jahren haben wir im Bereich der Bildverarbeitung besonderes Augenmerk auf die Verbesserung und Weiterentwicklung der Bildfilter gelegt. Dies gilt im Besonderen für die Entwicklung von neuen Filtern zur Entfernung von Artefakten in Grauwertbildern.
Für GeoDict 2021 haben wir unseren Fokus explizit auf die Vereinfachung und Qualität der Segmentierung gelegt. Für die Bildanalyse, und darüber hinaus auch noch für die Materialentwicklung, verfügt GeoDict über ein großes Angebot an Werkzeugen bzw. Modulen. Da haben wir beispielsweise das Modul PoroDict, für die Analyse des Porenraums, kombiniert mit MatDict, für die Analyse des Materials selbst. FlowDict dient dazu Strömungseigenschaften zu berechnen und ElastoDict, um plastische Verformungen und damit Schädigungen vorherzusehen. Und das ist nur eine kleine Auswahl an Modulen und Berechnungsmöglichkeiten.
Eine Hardware- oder Gerätebindung gibt es bei GeoDict nicht. GeoDict läuft auf allen handelsüblichen Windows und Linux Rechnersystemen. Schnellere Rechnersysteme sind speziell bei Simulationen von Vorteil. Da GeoDict darauf ausgelegt ist, parallel zu arbeiten, bringen mehr Berechnungseinheiten nicht nur schnellere Ergebnisse, sie sparen auch Zeit und Geld. Der limitierende Faktor bei der Hardware ist der Arbeitsspeicher. Wer hier große Mikrostrukturen rechnen möchte, braucht auch entsprechend viel Arbeitsspeicher. Die bisher größte Rohstruktur, die wir aus einem 3D-Bilddatensatz in GeoDict importiert haben, lag bei rund 18.000 x 4000 x 2000 Voxeln. Aber in GeoDict gibt es keine Größenbeschränkung.
Auch bei den Aufnahmegeräten sind wir nicht an einen Gerätetyp oder Gerätehersteller gebunden. Egal ob µCT, CT, FIB-SEM oder Synchrotron, wichtiger ist vielmehr das Datenformat, welches am Ende herauskommt. Und da deckt GeoDict die gängigsten Bildformate (raw, vol, rek, txm, am, vox, iass, tif(f), jpeg, png, uvm.) ab, egal ob im Stapel oder als einzelne Bilder.
Den prototypischen Workflow gibt es so nicht. Die Vorgehensweise hängt immer ein bisschen von den Eingangsdaten ab. Sind diese bereits segmentiert oder liegen sie noch als Rohdaten vor? Es spielt auch eine Rolle, ob man nur die Segmentierung in GeoDict erledigt und danach mit den Ergebnissen direkt in einer anderen Software weiterarbeitet oder die weiteren Fähigkeiten von GeoDict nutzt. Gehen wir davon aus, man möchte alles in GeoDict durchführen - die Bildverarbeitung, das Säubern der Daten, die Segmentierung, die Analyse der Materialeigenschaften - dann kann man das auch genau in dieser Reihenfolge in GeoDict als Workflow umsetzen. GeoDict bietet somit alle Werkzeuge an, die man braucht, um aus seinem 3D-Datensatz das Beste rauszuholen.
Wie zu Beginn erwähnt, ist der Arbeitsspeicher der limitierende Faktor für die Größe des Datensatzes. Große Daten brauchen viel Arbeitsspeicher. Ist dieser gegeben, kann GeoDict die Bildverarbeitung reibungslos umsetzen.
Schwierig wird es speziell bei Materialien, in denen sich verschiedene Komponenten in der Aufnahme nicht mehr auseinanderhalten lassen. Meistens aufgrund von sehr ähnlichen Dichte- und Absorptionseigenschaften. Hier kann sich eine alternative Aufnahmetechnik und Herangehensweise lohnen. So etwas sehen wir häufig im Bereich von Verbundwerkstoffen und Fasermaterialien, die einen Bindestoff enthalten oder Elektrodenmaterialien, in denen sich das Carbon Black nur schwer vom Aktivmaterial unterscheiden lässt.
Spannend wird es bei den verschiedenen Dimensionen der Datensätze. Bisher haben wir hier vorrangig den 3D-Datensatz erwähnt. Es ist aber auch durchaus üblich mit 2D-Datensätzen zu arbeiten, z.B. mit Schliffbildern. Was wir hoffentlich noch dieses Jahr präsentieren können, ist ein Ausblick auf das Arbeiten mit 4D-Datensätzen. Nicht nur das Bildverarbeiten, sondern vor allem die Analyse dieser Daten ist hier überaus spannend.
Der nächste Schritt im Workflow wäre dann das Sichten und Korrigieren der Bilddaten. In GeoDict 2021 haben wir besonders hinsichtlich der Nutzerführung die Benutzeroberfläche verbessert. Bild- und Segmentierungsfilter sowie weitere Einstellungen sind jetzt noch eindeutiger als Workflow dargestellt und lassen sich auch als Workflow-Makros aufzeichnen, abspeichern und wiederverwenden.
Wir starten in der Benutzeroberfläche zuerst bei der Optimierung der Bilder. Für die Analyse ist es entscheidend, wie präzise der Datensatz segmentiert wurde. Das bedeutet, dass die Bilder für GeoDict gut erkennbar sein müssen, um bei der Segmentierung das beste Ergebnis zu erzielen. Um hier Zeit zu sparen, empfehlen wir mit der Bestimmung der Region-Of-Interest zu starten. Es wird meistens mehr aufgenommen, als der Bereich, der einen interessiert. Schon deshalb, weil man diesen Bereich durch das Präparieren der Probe nicht beschädigen möchte. Die uninteressanten Randbereiche kann man dann einfach weg schneiden. Dadurch wird der Datensatz etwas kleiner und die Bildfilter werden schneller berechnet. Das ist händische Arbeit notwendig, da die Maschine nicht eigenständig eine Auswahl des relevanten Bereichs treffen kann. Wenn man jedoch weiß, dass alle Aufnahmen so aussehen, dann kann man sich hier ein Workflow-Makro definieren, abspeichern und dieses dann jederzeit auf die Datensätze anwenden.
Mit den Bildfiltern kann man im nächsten Schritt das Bildrauschen reduzieren oder die Kanten nachschärfen. Das hilft später bei der Segmentierung der Bildbereiche und verbessert die Qualität der Daten. Auch hier ist es erstmal notwendig, die richtigen Parameter für die Bildfilter manuell herauszufinden, um es sich dann als Workflow-Makro abzuspeichern. Gerade für Aufnahmeartefakte, wie z.B. Streak- und Ringartefakte, haben wir bereits in GeoDict 2020 große Fortschritte gemacht. Solche Artefakte lassen sich bei der Aufnahme nur schwer vermeiden und stören die Qualität enorm. Dies wirkt sich dann auch auf die Qualität der späteren Analyse aus. Um das zu vermeiden, haben wir beispielsweise speziell für FIB-SEM Aufnahmen einen sogenannten Alignmentfilter entwickelt, da aufgrund der technischen Gegebenheiten beim Aufnahmeverfahren die Einzelaufnahmen gegeneinander verrutschen können. Der Alignmentfilter korrigiert dieses Verrutschen wieder.
Sollte man jetzt doch noch einen Wunsch offen haben, was Bildfilter betrifft, kann man über das Python-Interface in GeoDict auch eigene Bildfilter implementieren.
Gerade bei der Segmentierung ist viel Feinabstimmung und Justierung nötig, um den Materialien nicht zu viel oder zu wenig Grauwerte zuzuordnen. Wie kann GeoDict unterstützen? Und wie stellt man sicher, die richtigen Parameter gefunden zu haben?
Da gibt es verschiedene Methoden, die zum einen in Abhängigkeit zur Qualität des Datensatzes stehen und zum anderen abhängig von der Komplexität des Datensatzes sind.
Kennt man seine Proben, sein Gerät und weiß aus Erfahrung, in welchen Grauwertbereichen sich welches Material befindet, kann man diese Grenzwerte für seine Materialien manuell in GeoDict eingeben. Hier würde sich eine Automatisierung durchaus lohnen, um Zeit zu sparen. Sei es per Python-Interface in GeoDict 2020 oder - jetzt neu in GeoDict 2021 - direkt über die Workflow-Makros.
Hat man es dann jedoch eher mit wechselnden Materialproben oder Geräten zu tun, empfiehlt es sich, die Segmentierungsfilter zur Hilfe zu nehmen.
Im besten Falle kann man mit der Otsu-Methode seinen Datensatz mit einem Klick voll automatisiert segmentieren lassen. GeoDict berechnet, wie sich die Materialien, oder Phasen, am besten voneinander trennen lassen und wendet es dann auf den Datensatz an. Die Otsu-Methode benötigt dabei keine Nutzereingabe, was das Ergebnis zuverlässig reproduzierbar macht.
Bei komplizierteren Datensätzen, z.B. bei mehreren Materialien oder Phasen in einem Datensatz, wird es schon kniffeliger. Zwar kann man auch hier noch die Otsu-Methode anwenden, nur reichen dann meistens die Kontraste im Datensatz nicht mehr aus, um die verschiedenen Materialien zuverlässig voneinander zu trennen. Um hier den Nutzer noch besser zu unterstützen, haben wir für GeoDict 2021 einen neuen KI-Segmentierungsfilter entwickelt.
Dabei markiert man im ersten Schritt manuell die unterschiedlichen Materialien im Datensatz mit verschiedenen Kennzeichen. Gleiches Material erhält das gleiche Kennzeichen. So lernt die künstliche Intelligenz, welche Werte welches Material repräsentieren und segmentiert dann zuverlässig den Datensatz. Das Kennzeichnen erledigt man bequem in ImportGeo-Vol per Pinselwerkzeug, indem man direkt im Datensatz die Materialien mit dem entsprechenden Kennzeichen für das Material anmalt. Man ist hier völlig frei, auf welchen Scheiben oder Bildern des Datensatzes man arbeiten möchte. Schließlich kann es durchaus sein, dass nicht alle Materialien auf einem Bild des Datensatzes vorhanden sind.
Im zweiten Schritt kann man sich dann eine Vorschau der Segmentierung anzeigen lassen. Bereiche, die hier falsch von der KI erkannt wurden, kann man dann zusätzlich als Trainingsdaten markieren, um die KI-Erkennung zu verbessern. Sobald man mit dem Ergebnis zufrieden ist, kann man sich das trainierte Modell der KI abspeichern und dann auf ähnliche Datensätze anwenden.
Aber jede Segmentierung ist nur in dem Maße gut, wie sie das tatsächliche Material digital repräsentiert. Da es keinen einheitlichen Messwert oder einheitliche Kennzahlen gibt, anhand dessen man die Qualität einer Segmentierung messen kann, ist es dann auch schwierig zu bestimmen, wie repräsentativ unser digitaler Zwilling letztendlich ist.
GeoDict kann hier Abhilfe schaffen. Voraussetzung ist, dass man einen spezifischen Kennwert für sein Material kennt. Sei es nun statistisch gesehen, also man weiß z.B. auf dem Papier wie hoch der Feststoff-Volumenanteil in der Probe sein sollte, oder experimentell festgestellt, d.h. man kennt eine Eigenschaft seines Materials, z.B. den Druckabfall oder die Leitfähigkeit. In GeoDict kann man diese Kennwerte auf dem digitalen Zwilling dann bestimmen und mit dem Original vergleichen. Sind die Abweichungen dann außerhalb des Toleranzbereichs passt man die Segmentierung nochmal an. Die Abweichung kann einem dann schonmal eine Richtung vorgeben, in die man dann Verbesserungen vornehmen kann.
Um sich hier die Arbeit zu erleichtern kann man an diesem Punkt auf GeoDict's Kommandohistorie, das Session Makro, zurückgreifen. Dort werden alle Arbeitsschritte aufgezeichnet und können als Python-Skript abgespeichert, bearbeitet und wieder ausgeführt werden. So kann man auch schnell eine Reihe verschiedener Import-Parameter testen und validieren lassen.
Und am Ende bekommt man dann eine digitale Repräsentation seines Materials auf Voxelbasis in GeoDict, den digitalen Zwilling.
Von Kunden wissen wir, dass der eben beschriebene Workflow von Bildverarbeitung, Segmentierung und Validierung voll automatisch mit in deren Materialentwicklungs-Workflow integriert ist.
Was wir auch schon erlebten, war ein Fall, bei dem sich Experiment und Simulation stark voneinander unterschieden. Diese Abweichung ließ sich nicht durch normale Messschwankungen oder statistische Modelabweichungen erklären. Auch hatten wir von anderen Kunden noch keine solche Rückmeldung bekommen. Ganz im Gegenteil, bisher waren die Simulationsergebnisse stets verlässlich. Wir prüften GeoDict auf Herz und Nieren, ob hier ein Fehler in der Simulation verantwortlich war, und seitens des Kunden wurde das Experiment nochmal genauer unter die Lupe genommen. Es stellte sich heraus, dass ein defektes Bauteil im Experimentaufbau verantwortlich für den Fehler war.
Hier hatte also die Simulation das Experiment validiert. Dennoch raten wir keinesfalls von Laborexperimenten ab. Denn nur, wenn man zwei unabhängige Quellen miteinander vergleichen kann, lassen sich realistische und verlässliche Ergebnisse produzieren. Allerdings kann man mit der Hilfe von GeoDict bereits zu Beginn abwägen, ob sich ein kosten- und zeitintensives Experiment auszahlt.
Kommen wir nun auf die Analyse zu sprechen. Was ist hier in GeoDict möglich, welche Ergebnisse kann man erwarten?
Hier haben wir ein breites Spektrum an Informationen, die man durch GeoDict von seinem Material erhalten kann. Angefangen bei der geometrischen Bildanalyse, die auf dem Ergebnis der Segmentierung aufbaut, kann man hier z.B. Eigenschaften wie Porengrößenverteilung, Faserdurchmesser, Wanddicken, die Konnektivität des Porennetzwerkes, und noch vieles mehr bestimmen und vergleichen. Diese geometrischen Analysen sind unkompliziert und lassen sich zum Großteil direkt oder mit nur minimalem zeitlichen Aufwand aus der Geometrie des Materials auslesen.
Dank der Materialeigenschaftsbestimmung unter Anwendung von Simulationen in GeoDict lässt sich ein noch viel detaillierteres Bild des Materials zeichnen. Sei es die Filtrationsleistung seines Fasermediums zu bestimmen, tausende Ladezyklen auf seiner Elektrode zu simulieren, um die Haltbarkeit seiner Batterie zu ermitteln, oder per Zweiphasenströmung die relative Permeabilität zu bestimmen. Hier sind der physikalischen Eigenschaftsbestimmung praktisch keine Grenzen gesetzt. Und wenn doch freuen wir uns stets über Feedback, um GeoDict noch effizienter für unsere Kunden nutzbar zu machen.
Diese Analysedaten kann man dann, wie schon erwähnt, zum einen zur Validierung verwenden oder zum anderen, um vorherzusagen, wie sich das Material unter bestimmten Voraussetzungen und Einflüssen verhalten wird. Hier sind wir dann schon tief in der Materialforschung und Materialentwicklung angelangt.
Wo liegt hier der Vorteil bei der Materialentwicklung in GeoDict?
Materialentwicklung ist hier das Stichwort für die letzte Frage. Wo liegt hier der Vorteil bei der Materialentwicklung in GeoDict. Im Speziellen aus der Sicht der Bildanalyse, wie sieht hier der Workflow in GeoDict aus?
Der Vorteil der Simulation ist, dass man bei der Materialentwicklung schneller vielversprechende Materialien im Vorhinein erkennen kann. Durch den detaillierten digitalen Blick ins Innere des Materials, den einem das Experiment so nicht bieten kann, erhält man zudem noch ein größeres Verständnis dafür, welche Parameter des Materials für die späteren Eigenschaften besonders wichtig sind. Durch diese Erkenntnisse spart man Zeit und somit auch Geld in der Entwicklung. Man muss nicht erst unzählige teure Prototypen anfertigen und testen, lediglich die vielversprechendsten Materialien werden gezielt im Laborexperiment validiert.
Für den Fall, dass GeoDict nicht das Ende der Pipeline ist und man danach noch andere Simulationen in einer weiteren Software durchführen möchte, kann man über das Export-Modul (ExportGeo) die Daten aus GeoDict in andere gängige Dateiformate umwandeln. Ein Beispiel dafür wäre, dass man die Mikrostruktur von Voxeln in ein Oberflächennetz übersetzt. Dadurch kann man GeoDict flexibel in seinen bestehenden Workflow integrieren.
Selbstverständlich wäre es von Vorteil alle Schritte in einer Software zu erledigen, um Reibungsverluste durch Ex- und Import zu vermeiden. In diesem Zusammenhang bietet GeoDict weitere Werkzeuge zur Materialentwicklung an, wie zum einen die Analyse- und Simulationsmodule, mit denen sich die statistischen Materialeigenschaften bestimmen lassen und zum anderen, die Materialdesignmodule, die diese statistischen Materialeigenschaften in ein Materialmodel zusammenführen. Was man am Ende erhält ist eine statistische Repräsentation des Originalmaterials, anschaulich visualisiert in GeoDict. Es unterscheidet sich eventuell optisch vom Original, aber statistisch gesehen ist es dasselbe Material, ein statistischer Zwilling. Als hätte man seine Materialprobe einfach ein Stück weiter seitlich entnommen.
In GeoDict 2020 sind wir mit den Find-Modulen bereits den ersten Schritt in Richtung intelligenter, maschinengestützter Materialentwicklung gegangen.
In GeoDict 2021 sind wir jetzt noch ein paar Schritte weiter vorangeschritten. Die Find-Module verwandeln Daten zu Informationen mit Hilfe von neuralen Netzwerken, die sich durch Training auf die jeweiligen Datensätze anpassen lassen. Dadurch erhalten wir neben der Bildverarbeitung und der Bildanalyse noch zusätzlich die Bilderkennung. Durch FiberFind erhält man beispielsweise einen exakten digitalen Zwilling aus seinem Fasermedium-Datensatz, der aber nicht mehr nur eine Voxelrepräsentation ist. Jede einzelne Faser wird als eigenständiges Objekt erkannt. Das meinen wir, wenn wir davon sprechen aus Daten Informationen zu machen. Wir haben nun die Information jeder einzelnen Faser, kennen ihre Länge, ihren Durchmesser, ihre Krümmung, etc. Was bisher aber nur für Fasern (FiberFind) und eingeschränkt für Körner (GrainFind) möglich war haben wir in GeoDict 2021 um ein generelles Find-Modul für jegliche Arten von Materialformen verfügbar gemacht. Mit ObjectFind kann man ein eigenes neurales Netzwerk auf eine Objektform trainieren und auf seine Datensätze anwenden.
Für die Materialentwicklung bedeutet das in GeoDict 2021, dass die Ergebnisse aus den Find-Modulen direkt in die entsprechenden Materialdesignmodule als Generierungsparameter eingetragen werden. Das spart dem Nutzer das Zusammentragen der relevanten Generierungsparameter per Hand und liefert insgesamt ein präziseres Ergebnis.
Zuletzt erzeugt man dann aus dem statistischen Zwilling einen digitalen Prototypen. Da man nun die Parameter kennt, die das Material definieren, kann man diese im Materialdesignmodul beliebig verändern. Per Simulation wird dann die Auswirkung der Modifikation auf die Materialeigenschaften bestimmt und mit dem gewünschten Ergebnis verglichen. Diese Schleife von Design und Simulation lässt sich über das Python-Interface in GeoDict voll automatisieren. Man hat den enormen Vorteil nicht auf die Produktion und dann das Labor warten zu müssen. Ja, auch bei GeoDict muss man die Simulation erstmal abwarten, aber da reden wir über Stunden oder Tage, nicht über Wochen oder Monate. Diesen Workflow kann man bequem per GeoPy aufsetzen und GeoDict über das Wochenende für einen arbeiten lassen, automatisch.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man mit GeoDict nicht nur eine Software zur Optimierung des Materialdesigns erhält, sondern mit Augenmerk auf die Bildverarbeitung, vorallem auch ein starkes Tool zur Materialanalyse, welches hierfür unentbeehrlich ist. Beides in Kombination ermöglicht die Materialentwicklung von morgen. Mit unserer in GeoDict 2021 weiterentwickelten KI zur Materialsegmentierung und Objekterkennung, bringen auch Sie ihr Material schnell und einfach auf das nächste Level!
Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kleinen Einblick geben konnten, was jetzt schon mit GeoDict möglich ist und in GeoDict 2021 sein wird.
Wir freuen uns über Ihr Feedback, als Kommentar auf LinkedIn oder per E-Mail.
Vielen Dank,
Ihr Math2Market Team.