GeoDict 2021 Vorschau: Trainieren Sie Ihre eigene KI - Verbesserte Objektidentifizierung für schnellere Bildverarbeitung
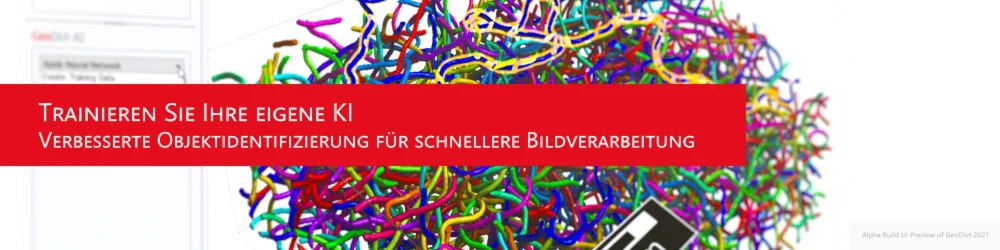
Was genau kann GeoDict im Bereich der KI-gestützter Bildverarbeitung und Objektidentifizierung, um ein Material wirklich zu verstehen?
GeoDict ist die Digitalisierung des Materiallabors. Durch die Errungenschaften bei den bildgebenden Verfahren sind 3D-Bilddaten im Mikro- und Nanometerbereich präziser und erschwinglicher geworden. Dank dieser Entwicklungen können wir Materialien in einer neuen Dimension erfahren und verbessern.
GeoDict bietet die Möglichkeit 3D-Bilddaten visuell darzustellen und ermöglicht darüber hinaus Experimente zur Bestimmung der Materialeigenschaften digital durchzuführen. Diese digitalen Eigenschaftsvorhersagen erlauben Einblicke in bisher verborgene Prozesse der Mikrostruktur von Materialien. Doch lassen sich nicht nur Eigenschaften von existierenden Materialien vorhersagen. Mit denAber nicht nur Eigenschaften von bestehenden Materialien können vorhergesagt werden - neue und revolutionäre Materialien können durch die Materialdesignmodulen in GeoDict digital entwickelt werden.
Bisher gab es jedoch noch eine Kluft zwischen der Materialanalyse und der Materialentwicklung. Das Erzeugen eines statistischen Modells anhand der Analysen des digitalen Zwillings war bisher nur beschränkt möglich. Informationen, wie etwa die Kurvigkeit einer Faser, konnten nur durch manuelle Messungen gewonnen werden. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz auf Basis der neuronalen Netzwerke brachte dann den entscheidenden Durchbruch.
FiberFind-AI überwindet die Kluft zwischen dem digitalen und statistischen Zwilling für Fasermedien durch die KI-gestützte Bilderkennung von Fasern in 3D-Bilddaten. Mit Hilfe der KI können Fasern nun als eigenständige Objekte erkannt und analysiert werden. Informationen wie Faserdicke, Faserlänge und die Faserkurvigkeit sind dadurch für Fasermedien mit einem Klick automatisch verfügbar. In GeoDict 2021 haben wir diese Innovation nun weitergedacht - eine generelle Objektidentifizierung basierend auf nutzerdefinierten neuronalen Netzwerken.
Der digitale Zwilling spiegelt in der Regel sein reales Gegenstück eins-zu-eins wider. So lassen sich Vorhersagen durch Simulationen mit dem digitalen Zwilling auf das Original projizieren. Zum Beispiel lässt sich der Zeitraum einer Materialbeanspruchung in Tage oder Stunden herunterskalieren und das Materialverhalten simulieren. Schwachstellen können so im Vorfeld identifiziert und eliminiert werden.
In GeoDict sprechen wir bei einer digitalen eins-zu-eins Repräsentation des Originals ebenfalls vom digitalen Zwilling. Diesen erhält man beim Import von 3D-Bilddaten in GeoDict. Mit diesem digitalen Zwilling lassen sich alle Analyse- und Simulationsmöglichkeiten von GeoDict nutzen.
Die Besonderheit von Mikrostrukturen ist die Komplexität bei der Erfassung von repräsentativen Materialproben. Meist müssen dazu mehrere Proben entnommen, analysiert und ausgewertet werden, um lokale Unregelmäßigkeiten auszugleichen. Dadurch entsteht ein statistisches Modell. Dieses statistische Modell kann in GeoDict mit Hilfe der Materialdesignmodule generiert und visualisiert werden. Es entsteht der statistische Zwilling. Anders als der digitale Zwilling repräsentiert er nicht die Daten des Materials, z.B. die 3D-Bilddaten, sondern die Informationen, z.B. Faserlängen, Korngrößenverteilung, Porosität, und vieles mehr. Anhand dieses statistischen Modells lassen sich unzählige statistische Zwilling in unterschiedlichen Größen und Auflösungen erzeugen und die Eigenschaften per Simulation vorhersagen.
Der große Vorteil des statistischen Zwillings ist das zugrundeliegende, statistische Modell, welches das Material anhand von Informationen beschreibt. Diese Informationen lassen sich verändern und anpassen, durch die Materialdesignmodule in GeoDict darstellen und die Eigenschaften per Simulation vorhersagen. So erhält man schnell und einfach unzählige digitale Prototypen und deren Eigenschaften – ohne Produktionskosten oder logistische Wartezeiten.
In welchen Bereichen unterstützt GeoDict mit Hilfe von künstlicher Intelligenz den Nutzer bereits jetzt?
Zuverlässige Segmentierung von Objekten und Bindemittel in CT-Scans
Bei klassischen Schwellwertverfahren (Treshholding) werden Bildstrukturen in CT-Scans anhand ihrer unterschiedliche Graustufen erkannt und segmentiert. Da Objekte wie Fasern oder Körner den gleichen Grauwert wie das umgebende Bindemittel im CT-Scan aufweisen, konnten sie bisher kaum voneinander getrennt werden. Die künstliche Intelligenz in BinderFind verwendet eine andere Methode – sie schaut sich die geometrische Form der Objekte an und kann diese zuverlässig vom Bindemittel segmentieren. Im nächsten Schritt können Sie dann die Objektarten in der Materialstruktur identifizieren. Diese Erkennung von Binder ist bisher nur für Fasermedien möglich.
Eindeutige Identifizierung von Objektarten in CT-Scans
In einer Materialstruktur können auch mehrere Objektarten, definiert durch unterschiedliche geometrische Eigenschaften, vorhanden sein. Wenn sie sich in der Materialstruktur berühren oder übereinander liegen, werden sie in Schwellwertverfahren als eine Zusammenhangskomponente markiert. Dadurch können Objektarten nicht automatisch erkannt werden. Eine manuelle Vermessung der Objekte ist allerdings nur schwer oder gar nicht möglich.
Mit FiberFind-AI identifizieren und analysieren Sie dank künstlicher Intelligenz die verschiedenen Faser-Arten wie etwa in der Gas-Diffusionsschicht (GDL) einer Brennstoffzelle. Sie erhalten dadurch wertvolle Informationen, z.B. zur Anzahl der Fasern, der Längenverteilung, Durchmesserverteilung, Krümmung und Orientierungsverteilung im dreidimensionalen Raum. Die Auswertung dieser statistischen Daten (Postprocessing) direkt aus FiberFind heraus bietet Ihnen übrigens in GeoDict 2021 noch mehr Informationen in Form von z.B. Graphen und Videos wie bisher. Mit diesen Informationen können Sie dann in FiberGeo eine realitätsnahe Mikrostruktur, den sogenannten statistischen Zwilling, erstellen.
Der Ansatz in GrainFind basiert zwar nicht auf KI, verfügt aber über sehr leistungsfähige Algorithmen, die Ihnen eine vergleichbar präzise Identifizierung und Analyse von Kornarten aufgrund der Korngröße, Form oder Lage im Raum ermöglichen. Mit diesen statistischen Informationen können Sie dann in GrainGeo einen realitätsnahen statistischen Zwilling erstellen.
Realitätsnahe Simulation auf Basis des digitalen / statistischen Zwillings
Die präzise Segmentierung der CT-Scans durch KI ist die Voraussetzung für einen exakten, digitalen Zwilling. Das heißt, alle Experimente, denen dieser digitale Zwilling zugrunde liegt, liefern Ihnen realistische Vorhersagen zum Verhalten des Materials.
Auf dem Weg vom digitalen zum statistischen Zwilling unterstützen Sie die Analyse- und Find-Module. Hier werden 3D-Bilddaten mit Hilfe von smarten Algorithmen und neuronalen Netzwerken zu statistischen Informationen, wie z.B. Faserverteilung und Korngrößen, konvertiert.
Der statistische Zwilling ist der Ausgangspunkt für die Entwicklung neuer Materialien. Die zugrunde liegenden statistischen Modelle des statistischen Zwillings können in den Materialdesignmodulen modifiziert werden. Im nächsten Schritt werden die Eigenschaften dieses neuen Materials, dem digitalen Prototypen, per Simulation vorhergesagt und vom Nutzer bewertet. Beispielsweise können Sie das Verhältnis der dicken und dünnen Fasern im statistischen Modell verändern und nun analysieren, wie sich diese Modifikation etwa auf den Strömungswiderstand in der Filtration oder auf die mechanischen Eigenschaften auswirkt.
Durch das globale Python-Interface in GeoDict lassen sich Informationen im statistischen Modell per Skript modifizieren und analysieren. So erzeugen Sie unzählige digitale Prototypen, ohne diese kostenintensive produzieren zu müssen. Das spart Ihnen erheblich Zeit und Geld in der Entwicklung eines Materials.
So haben Sie die gesamte Werkzeugkette der Materialentwicklung direkt vor sich, in einer umfassenden und einfach zu bedienenden Software.
Was verspricht uns GeoDict 2021 in Puncto künstlicher Intelligenz?
Neu: Segmentierung durch interaktives Labeling von 3D CT-Scans
Die klassische Methode: Um Trainingsdaten für ein neuronales Netz zu erhalten, benötigen Sie vorab für die Trainingsstrukturen genügend CT-Bilder, in denen Sie dann Objekte von Hand in jeder CT-Schicht markieren müssen. Für 3D-Datensätze ist diese Vorgehensweise kaum durchführbar.
Interaktives Labeling wird bisher nur auf CT-Datensätze in 2D, häufig in der Medizin, angewendet. Bei dieser Methode markiert man in den Schichten eines CT-Datensatzes grob ein oder mehrere interessante Objekte mit jeweils einer beliebigen Farbe. Die Idee: Der Algorithmus in der Software lernt daraus inkrementell immer besser, Objekte zu erkennen und zu segmentieren.
In GeoDict 2021 sind Sie mit dem Modul ImportGeo-Vol-AI in der Lage, diese Methode sogar auf 3D CT-Datensätze anzuwenden. Während Sie damit beginnen, verschiedene Objekte farblich auf einer CT-Schicht zu markieren, lernt der Algorithmus und bietet Ihnen, resultierend aus dem bisher Erlernten, Vorschläge für die Vervollständigung der Markierung an. Sie können diese Vorschläge prüfen und ggf. korrigieren oder weitere Objekte markieren, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen.
Auf diese Weise wird der Algorithmus interaktiv von Ihnen trainiert, die Objekte komplett in allen CT-Schichten präzise zu erkennen und dieses Wissen auch künftig in neuen CT-Datensätzen anzuwenden.
Neu: Trainieren eigener neuronaler Netze
Auch wenn GeoDict fertige neuronale Netze bereits zur Verfügung stellt, gibt es sicherlich immer wieder auch den Bedarf, eigene neuronale Netze zu erstellen. Das kann der Fall sein, wenn besondere Geometrien in der Mikrostruktur erkannt werden müssen.
In GeoDict 2021 unterstützt Sie das Modul GeoDict-AI dabei:
1. Erstellen von Trainingsstrukturen
GeoDict besitzt einzigartige Objektgeneratoren, mit denen wir unsere Trainingsstrukturen für alle Arten von Objekten (die mit GeoDict darstellbar sind) innerhalb kürzester Zeit selbst erzeugen können. Der Objektgenerator wird vom Anwender über ein Python-Skript so konfiguriert, dass die Daten mit dem realen Material bzw. den CT-Daten übereinstimmen. Darauf basierend werden in GeoDict Trainingsstrukturen erzeugt. Der einzigartige Vorteil von GeoDict ist hierbei, dass die Materialinformationen erhalten bleiben. Ein aufwendiges manuelles Labeling ist nicht notwendig.
2. Trainieren eines Netzes
Auf Basis der erzeugten Trainingsstrukturen wird nun das neuronale Netzt trainiert. Aus unserer Erfahrung benötigt dieser gesamte Prozess auf einem Rechner mit einer Consumer Nvidia GTX 1080 maximal 4 Tage.
Das neuronale Netz kann nun verwendet werden, um die Objekte in CT-Scans zu erkennen.
Welche Vorteile bringen diese Verbesserungen?
Sie sparen sehr viel Zeit und Geld, weil ...
- die Herstellung von Prototypen stark reduziert wird
- das manuelle Labeln / Markieren in den CT-Scans wegfällt
- die digitalen Trainingsdaten wiederverwendet werden können
Sie gewinnen ...
- verlässliche Simulationsergebnisse aufgrund hochwertiger Ausgangsdaten